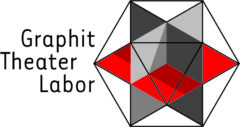Die Arbeitsweise von Judith von Radetzky
(nach der Etudenarbeit von A.Vassiliev/K. Stanislawski)
Ein Workshop-Erfahrungsbericht
Vor 2 Monaten habe ich einen Workshop mit Judith v. Radetzky besucht, weil mich ihr Flyer interessiert hat. Es klang nach tiefer schürfender Theaterarbeit, nach Neuem, nach Suchen, nach all dem, wozu man in der normalen Probenarbeit kaum Zeit hat.

Wir haben uns anhand des Shakespeare Stückes „Maß für Maß“ der Etuden- Arbeit von Stanislawski genähert. Diese spezielle Arbeit an einem Text, hat sich in der westeuropäischen Welt noch nicht so verbreitet, wie Stanislawskis andere „Methoden“ („The Method“), da er diese in seinen späten Jahren entwickelt hat, als der Eiserne Vorhang schon gefallen war.
Ich glaube, ich kann noch nicht zu Gänze sagen, was diese Arbeit alles beinhaltet, aber der Kern ist folgender:
Man unterteilt den Text/ die Szene in viele kleine Sinneinheiten und spielt diese Abschnitte erstmal lange mit eigenen Worten durch. Man weiß also, wer wann was zu sagen hat, aber man sagt es mit eigenen Bildern und Worten (ausgehend natürlich von der Erfahrungswelt der jeweiligen Figur und sich selber). Man kaut so lange an einem Bild herum, wie man möchte. Loopings sind erlaubt, alles was dazu dient, den Text mit eigenen Bildern anzureichern. Schrittweise wird dieses Improvisieren über den Text zurückgefahren, bis nur noch der eigentliche Text überbleibt, den man in einer Art und Weise verstanden, durchdrungen und sich zu eigen gemacht hat, wie es sonst im Theater nicht möglich ist. Am Ende kann man nur noch den eigentlichen Text sagen, weil er ein Konzentrat dessen ist, was man vorher entwickelt hat.
Das heißt, dass man in dieser improvisatorischen Arbeit sehr bei sich bleibt und von sich ausgeht. Natürlich hat man eine Figur vor Augen- in meinem Fall war das Isabella, eine Novizin, die erst alles Körperliche als Hindernis auf ihrem geistlichen Weg ablehnt und am Ende den Herzog heiraten wird, weil sie in ihrer Entwicklung lernt, dass auch die Verbindung zwischen Mann und Frau eine geistige Ebene öffnen kann.
Man gibt sich als Schauspieler preis, versteckt sich nicht hinter einer Rolle. Was in weiterer Folge auch bedeutet, dass man dem Zuschauer sich ganz anders preis gibt. Etwas sagt über sich, seinen Haltungen, Anschauungen.
Judith sagte einmal, Stanislawski hätte gesagt: Das Theater, ohne Gott, ist tot. Und interessanterweise kamen wir auch immer auf „höhere“ Themen zu sprechen, zu denen man irgendeine Haltung beziehen muss. Welche auch immer.
In diesem Sinne habe ich eine Arbeitsweise erlebt, die auf ganz andere Art gesellschaftliche Relevanz hat. Eigentlich etwas, was man sich immer vom Theater gewünscht hat, was aber im Alltagsprozess immer wieder versickert. Ein Theater, das Stellung bezieht, dadurch, dass Menschen auf der Bühne Stellung beziehen. Sehr spannend.
Die Probensituation sah so aus, dass wir morgens immer ein Training machten. D.h. Übungen, die die Sinne und Antennen des Menschen und Spielers auf die konkrete Arbeit vorbereiten- inhaltliche Vorübungen, Partner- und Gruppenübungen, Übungen, die die Etüdenarbeit verständlicher machen…
Danach gab´s eine Besprechung des jeweiligen Abschnitts mit Judith. Und dann haben sich die Partner zusammen auf die Szene vorbereitet. Sehr hilfreich war, dass drei von den Teilnehmern schon länger mit der Arbeit vertraut waren und man so gut von dem Partner lernen konnte. Den Abschluss machte die eigentliche Etudenarbeit. Die Paare haben dabei selbst bestimmt, wann sie dazu bereit waren. Und los ging´s, ohne Netz und doppelten Boden.
Das hat mal super geklappt, mal gar nicht. Aber so ist das, wenn man Neues lernt. Ich denke, so ist das bei dieser Arbeitsweise generell. Weil sie eben so stark mit den Spielern verknüpft ist. Dann hängt der Erfolg plötzlich von allem ab: ob man bereit ist sich zu öffnen, zusammenspielt, bei Kräften ist, Lust hat/ Angst hat, sich Zeit nimmt, einlässt…
Diese Arbeit lernt man nicht in 8 Tagen (so lange ging der Workshop, den ich besucht habe). Aber ich habe eine Ahnung bekommen, was Theater sein und leisten kann. Und ich habe Dinge, Kniffe, gelernt, die mir in meiner jetzigen Theaterarbeit großartige Dienste leisten- Britta und ich haben dadurch für uns in unserem gemeinsamen Kinderstück „Die Prinzessin und das Küchenmädchen“ einen Durchbruch an einer Stelle erzielt, die nie richtig funktioniert hat- nach 5 Jahren Spielen desselben Stückes!-…
Also ich fand diese Arbeit sehr lohnenswert, sehr spannend. Ich will mehr davon. Und ich wünschte, dass sich die Theaterwelt bei uns mehr darauf einlässt. Dann haben wir nämlich wieder ein Theater, dass die Gesellschaft spiegeln kann, dass schockieren und wachrütteln kann, nicht durch blöde Provokation, sondern durch Haltung.
Angela Eickhoff