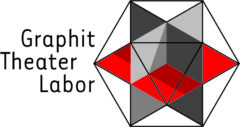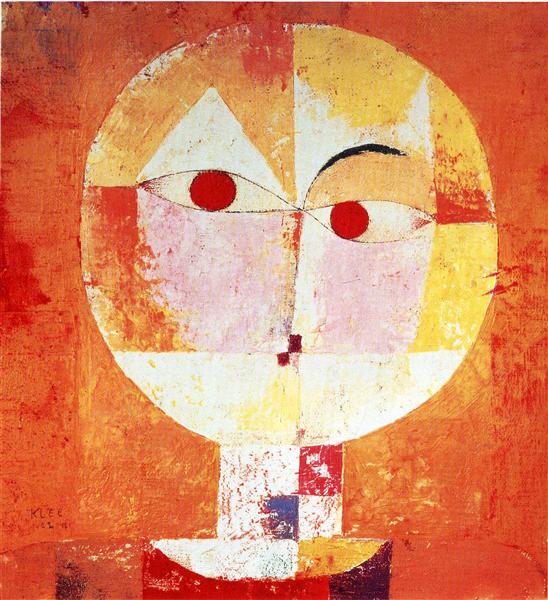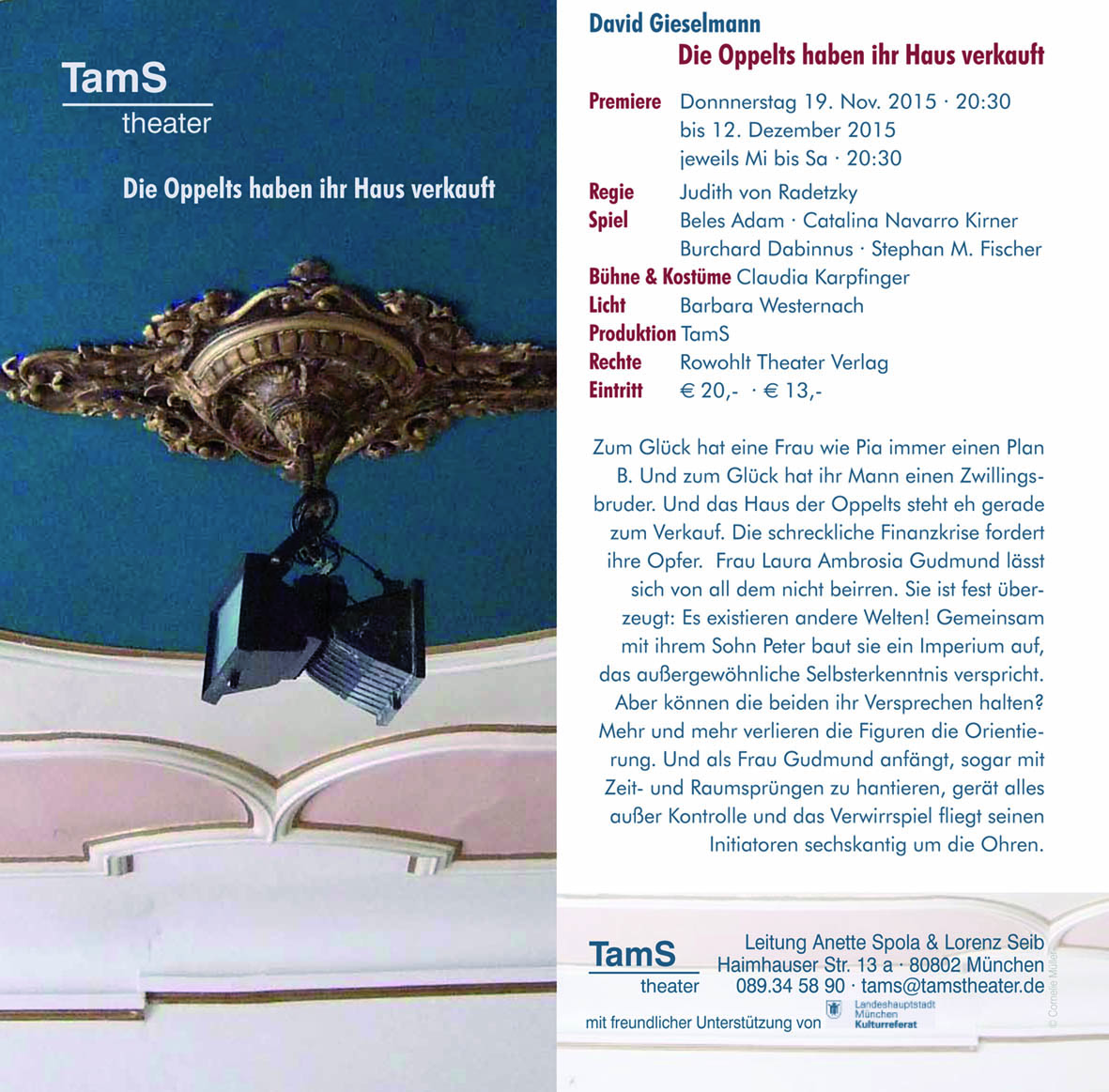Platon. Kleist. Kraznahorkai.
Im Sommer und Herbst 2010 erforschte das Ensemble von Graphit Theatertechniken anhand verschiedener Texte. Die Ergebnisse dieser Recherche wurde vom 11.-18. Dezember 2010 in fünf öffentliche Proben in den Uferstudios in Berlin-Wedding gezeigt.
Fotos und Aufführung Ion
Inhalt
Alle Dialoge verbindet die Frage: Auf welcher Ebene erzielt das Theater seine Wirkung?
Ist das Theater in der Krise? Kann es kein kollektives Empfinden mehr hervorrufen? Kann das Theater kein Ort der Erkenntnis mehr sein? Was ist Kunst überhaupt und was kann sie?
Graphit öffnete seine Tür und zeigte die Ergebnisse der Recherche der letzten drei Monate an einem Abend auf der Grenze von Improvisation, freier Komposition und fest vorgegebener Struktur. Anhand von Dialogen zur Kunst von Kraznahorkai, Platon und Kleist geht das Ensemble zusammen mit dem Musiker Kamil Tchalaev der in den Dialogen provokativ gestellten Frage nach: Ist es überhaupt möglich, ein Künstler zu sein?
In dem die Schauspieler diese Frage auf der Bühne zu ihrer eigenen machten, denn sie betrifft sie ja, gewannen die Dialoge an Kraft, Aktualität und Brisanz.
Der Festivalpreis 2012 geht an
ION
von Platon (Dialog aus dem Jahre 399 v.Ch.)
Jedes Theaterfestival will den Besten, den Originellsten, den neuen Star auffinden. Sokrates begegnet dem großen Ion aus Ephesus, einem renommierten Schauspieler, berühmt weit über die griechischen Landesgrenzen hinaus. Gerade wurde Ion bei einem der zahlreichen Theaterwettkämpfe, an dem er zum wiederholten Male aktiv teilgenommen hat, der Preis ‚Bester Darsteller des Jahres’ zuerkannt. Er kann das Publikum faszinieren, wenn er Homer spielt, über Stunden, in immer verschiedenen Rollen, Langeweile kommt bei ihm nicht auf.
Und da, in diesem Moment des Siegestaumels, hinter den Kulissen, taucht Sokrates auf, der sich für die Schauspielkunst begeistert- und hat noch diese und jene kleine Frage.
Was ist wohl Ions Geheimnis, woher der große Erfolg, was ist das für eine Kunst, die er beherrscht? Ja, ist es überhaupt eine Kunst, existiert eine Kunst des Schauspielens?
Die Untersuchung geht überraschend in eine Richtung, die Ion ganz und gar nicht behagt…
Über das Marionettentheater – Heinrich von Kleist
Ein Tänzer, größter Star der Ballettszene und hochgelobt, sucht etwas wahrhaft Menschliches bei den Marionetten und ihrem Tanz, als Zuschauer sieht man ihn immer wieder auf dem Marktplatz einer kleinen Stadt, wo die kleine Bühne aufgeschlagen ist. Ein anderer, Kenner und Freund des Balletts, beobachtet ihn dabei. Er will ihm zur Rede stellen, ihm seine Motive entlocken, er kann nicht verstehen, was ein solcher meister hier zu suchen hat. So erfährt er, dass jener Meister die tanzende Kunst an ihrem Ende angelangt sieht, für ihn existiert sie nicht mehr- im Gegensatz zur Kunst des Marionettenspiels. Der Meister führt ihn in ein Labyrinth phantastischer Experimente, denen sich der Freund des Balletts schließlich mit keinem Argument, mit keiner bisherigen Erkenntnis, mit keinem noch so ausgeklügelten Gedanken, mehr entziehen kann… Für den Meistertänzer hat ein mechanisches Gebilde mehr Grazie als ein Mensch es je erlangen kann.
Ein tiefsinnig-ironisches Plädoyer für den Künstler als ein utopisches Genie, für einen „vollkommenen“ Spieler oder Tänzer, der sein geweitetes Bewusstsein gepaart mit Können dem Publikum zur Verfügung stellt.
Kraznahorkai – Ein Mörder ist geboren (Novelle)
Eine Mann, arbeitslos, hoffnungslos und in der Fremde, gerät, ohne es zu wollen, in Barcelona in eine Ausstellung von alten Ikonen hinein. Die Wirkung dieser Ikonen auf ihn ist so stark, das er flieht und rennend das Gebäude verlässt.
Was hat ihn so erschüttert?
Kraznahorkai konstruiert in dieser Novelle die Begegnung eines modernen Arbeitssklaven mit der religiösen Welt der Ikonen, ihrer Naivität, ihrer Schönheit, ihrer Verheißung, ihrem Gold, das für Reinheit steht. Der Arbeitssklave wird ein Messer kaufen…
Regie Judith von Radetzky, Musik Kamil Tchalaev
Es spielen Mathias Hörnke und Lars Jokubeit (Platon)/ André Scioblowski (Krasznahorkai), Stephan Maria Fischer und Anja Marlene Korpiun (Kleist)
Kritiken
14.12.2010
SPIEGELFECHTEREI
Der Raum in den Uferstudios erinnert an ein Klassenzimmer: Neonlicht, hoch angebrachte Fenster, Linoleumboden. Die Zuschauer sitzen entlang der Wände auf Klappstühlen, lauschen und gucken. Und versuchen nicht den Anschluss zu verlieren, denn es sind schon harte Brocken, die Regisseurin Judith von Radetzky und ihr Graphit-Theaterlabor dem Publikum da zum (geistigen) Kauen vorgeworfen haben: Anhand dreier »Dialoge zur Kunst mit Klavier und Trompete« geht das Ensemble der Frage nach, ob es möglich ist, ein Künstler zu sein.
Eine eindeutige Antwort findet der Abend nicht, zumal schnell feststeht, dass hier nicht eine fertige Inszenierung gezeigt wird, sondern eine öffentliche Probe an der Grenze zwischen Improvisation und vorgegebener Struktur. Judith von Radetzky, deren Methodik geprägt ist von der russischen Schule der Etüde, sieht ihre Produktionen im steten Wandlungsprozess begriffen und setzt auf die Kraft des Austauschs zwischen Schauspielern und Publikum – hier begleitet von avantgardistischen Trompeten- und Klavierklängen des Musikers Kamil Tchalaev.
Ursprünglich sollten die »Dialoge zur Kunst« Texte von Platon, Goethe und Kleist beinhalten. Doch da Darsteller André Scioblowski aufgrund privater Probleme wenig Zeit zum Proben blieb, wurde der Goethe-Dialoge ersetzt durch einen wunderbaren Monolog aus László Krasznahorkais Novelle »Ein Mörder wird geboren«. Eine gute Entscheidung, denn der zwischen absurder Tragikkomik und bitterem Zynismus schwankende Text des ungarischen Autors scheint dem hoch gewachsenen Scioblowski wie auf den Leib geschrieben.
Zudem holt der Funken sprühende Monolog die Zuschauer aus der Starre, in die der lange Auftakttext von Platon sie versetzt hatte. In »Ion« lässt Platon den Philosophen Sokrates mit dem kindlich-selbstzufriedenen Vortragskünstler Ion darüber diskutieren, ob Ions rhetorische und schauspielerische Fertigkeit göttlich inspiriert sind. Die beiden Darsteller agieren großartig und genießen ihre intellektuelle Spiegelfechterei sichtlich, doch ist das Streitgespräch als Einstieg schlicht zu kompliziert. Trotzdem: Wie Sokrates, den Matthias Hörnke als geistig überlegenen Künstlertyp im grauen Sakko gibt, den philosophisch unbeleckten Ion – von Lars Jokubeit dargestellt als eitler Mitte-Yuppie mit Hang zum Posieren – mehr und mehr in die Enge treibt, ist ein wunderbares Beispiel für edle Streitkultur.
Der letzte der drei »Dialoge« stammt von Kleist, dessen Essay »Über das Marionettentheater« die Grundfrage variiert, ob Gefühl oder Vernunft das Verhalten des Menschen steuert. Unübersehbar erotisch aufgeladen ist die Begegnung zwischen dem »Vernunftmenschen« Stephan Maria Fischer und der schönen Anja Marlene Korpiun als Tänzerin in geschlitztem weißen Kleid, die in der Quintessenz mündet, dass sich wahre Perfektion »nur in einer Puppe oder einem Gott« manifestiere.
Zusammen ergeben die »Dialoge zur Kunst« anspruchsvolles Theater, ästhetisch dargeboten – und passen somit gut in die Uferstudios, die sich mehr und mehr zu einer Tanz- und Theaterstätte außerhalb typischer Schubladenzuordnung entwickeln.
Anouk Meyer/Neues Deutschlan
Dialoge zur Kunst-Zuschauerkommentar
am 12.12.2010
Ein kühnes Unternehmen, theoretische, wenn auch dialogisch gehaltene Texte zur Kunst in den Theater-Raum zu stellen. Und…es ist gelungen!
Sokrates und Ion fechten einen zähen Zweikampf aus. Am Ende kann man sich vorstellen, dass – wie man sich erzählt – Ion zu denen gehört, die Sokrates den Schierlingsbecher gereicht haben. Matthias Hörnke und Lars Jokubeit ziehen den Zuschauer ganz und gar in ihren Bann, lassen Gedanken Gestalt werden im Raum, lassen durch die Intensität des Spiels auf der Beziehungsebene kaum spürbar werden, dass Platons insistierende Mäeutik ziemlich entnervend ist.
An die Stelle des Goethe-Textes tritt – zum Glück – André Scioblowski mit einem inneren Monolog nach einer Erzählung des ungarischen Autors Kraznahorkai, an dessen Ende der Zuschauer mit der Figur in einem unerträglichen Gefühl von Fremdheit zu Boden geht, und das, nachdem er endlich eine einzige Tür in dieser Welt offen findet, die zu einer Ausstellung von Ikonen. Wie Kunst auch zerstörerisch sein kann, erlebt der Zuschauer in diesem Spiel von großer Intensität.
Beinahe abrupt und befreiend entführen Anja M. Korpiun und Stephan Fischer mit dem Dialog über das Marionettentheater in die Welt der Leichtigkeit und Anmut. Mit Charme und Witz vermitteln sie die Erkenntnis, „welche Unordnungen, in der natürlichen Grazie des Menschen, das Bewusstsein anrichtet.“ (Kleist) Da sie doch keine Marionetten sind: ob ihr Bewusstsein wohl durch ein Unendliches gegangen ist?
Die minimalistisch eingesetzten Klänge und Töne des Musikers Kamil Tchalaev rhythmisieren, pointieren und erzeugen durchgehend eine vibrierende Spannung.
Man möchte sehr vielen Zuschauern diesen schönen Kunstgenuss im gar nicht so fernen Wedding gönnen.
Marianne Geist