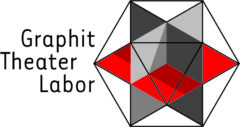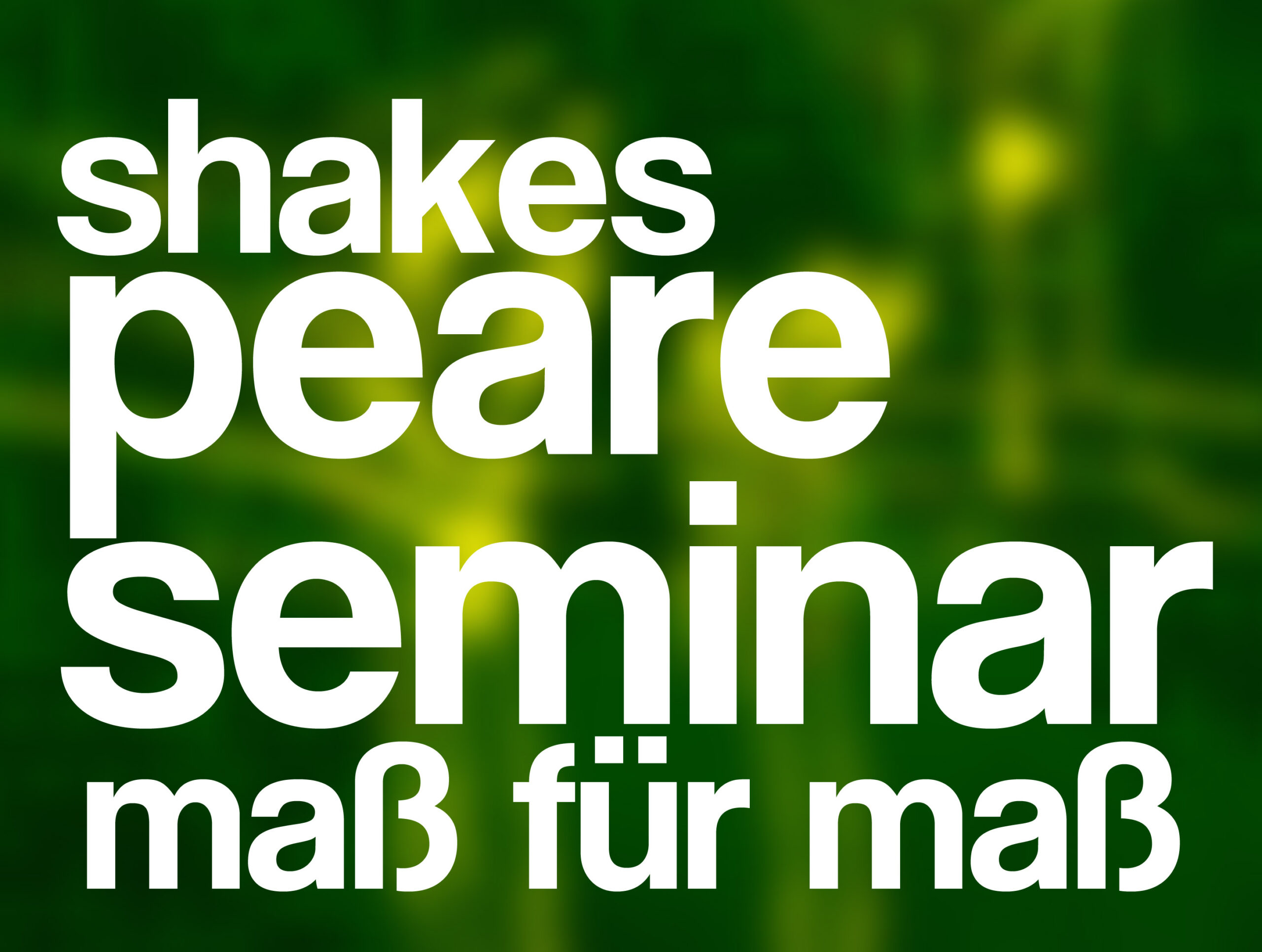DIE „SCHULE DER DRAMATISCHEN KUNST“ VON A. VASSIlJEV
DIE „SCHULE DER DRAMATISCHEN KUNST“ VON A. VASSIlJEV
und der Unterschied zur Schauspielausbildung in Deutschland
ein ehemaliger Teilnehmer berichtet:
Dieser Artikel geht größtenteils auf Erfahrungen zurück, die ich einerseits in Gesprächen mit Anatolij Vassiljev – Gesprächen über das Theater im Allgemeinen und über sein Verständnis von Theater – und andererseits im direkten Teilnehmen am Leben und Wirken der „Schule der dramatischen Kunst“ in Moskau während der letzten fünf Jahre gewonnen habe.
Die,“ Schule der dramatischen Kunst” in Moskau, die von Anatolij Vassiljev gegründet wurde und weiterhin geleitet wird, ist eine Art Zwitter.- sie ist gleichzeitig ein Theater und eine Theaterschule. Das ist der grundlegende Baustein, den man immer im Auge behalten muß und der sich auf jeden Aspekt der pädagogischen Tätigkeit und des Lebens der „Schule“ auswirkt, wie das Ziel der Studienkurse, ihre Strukturierung, die Auswahl der Studienfächer.
1) DER PÄDAGOGISCHE WEG ZUR BILDUNG DES THEATER-ENSEMBLES.
Beginnen wir mit den künstlerischen Zielen des Studienkurses. Die erste Zielsetzung des Studienkurses in der „Schule der dramatischen Kunst“ ist es, ein Ensemble zukünftiger Schauspieler des Theaters „Schule der dramatischen Kunst“ heranzubilden.
Der hierin zum Ausdruck kommende Pragmatismus sollte nicht erschrecken. Er ist Bestandteil einer alten Tradition der russischen Theater-Pädagogik, man denke nur an das Schicksal des Zweiten Studios des Theaters der Kunst in Moskau, das fast vollständig 1924 der Haupt- Truppe eingegliedert wurde, oder man denke daran, daß es heute noch, beim Mchat oder beim Vachtangoff-Theater, Institute für Theater- Ausbildung gibt, die unter anderem auch die Funktion haben, [31 den jungen Nachwuchs „heranzuziehen“. Diese „zielgerichtete“ Tradition ist im Bereich der russischen Pädagogik noch wichtiger geworden, seit in den 70-er Jahren (auf Vorschlag und Ausarbeitung von Andrej Gonkaroff, Chef-Regisseur des „Majakowskij“-Theaters in Moskau, dem der Regie-Kurs im GITIS – in der Staatliches Institut für Theaterkunst – anvertraut gewesen war) zunächst in Moskau, dann in Leningrad und schließlich in anderen Instituten zur Theater-Bildung in der UdSSR die Kurse zur Regie-Ausbildung mit denen zur Schauspiel-Ausbildung zusammengeschlossen wurden. Das weitverbreitetste Ergebnis dieser Operation war, die Leitung der Kurse für Schauspieler den wichtigsten Regisseuren und Künstlerischen Leitern der größten Theater anzuvertrauen (bisher war ihnen nur die Leitung der Regiekurse anvertraut worden) und Schauspieler aus der Leitung der Kurse auszuschließen. Diese Situation hat sich bis heute nicht verändert und in den meisten Fällen sind es in der russischen Theater-Lehre die Regisseure, die die Schauspieler erziehen. Diese Veränderung hatte zur Folge, daß seit damals der pädagogische Weg für die Schauspieler auch einige „Gebrauchsanweisungen“ für eine besondere Sprache und bestimmte Arbeitsmethoden einschloß, d.h. eine Sprache und Arbeitsmethoden, die dem Stil des den Kurs leitenden Regisseurs entsprechen. Die Schauspieler werden also während ihrer Ausbildung auch darauf vorbereitet, im Stile jenes Theaters zu arbeiten, an dem sie am Ende ihrer Studien engagiert werden sollen. Es sind hier zwei Beispiele zu nennen für diese Art Interaktion zwischen Regisseuren und Schulen, die dem italienischen Zuschauer bekannt sind, einmal das Malyi Dramaticeskij Teatr von Lev Dodin, dessen Truppe fast ausschließlich aus ehemaligen und derzeitigen Schülern von ihm besteht (Dodin lehrt am Theater-Institut in Sankt Petersburg), und zum zweiten das „Laboratorium“ (41 des moskovitischen Regisseurs Fomenko, dessen Schauspieler seine eigenen ehemaligen Schüler sind, die alle aus einem Kurs hervorgegangen sind (Fomenko lehrt an der Russischen Akademie für Theaterkunst in Moskau). Die „Schule der dramatischen Kunst“ in Moskau ist daher keine Ausnahme, ganz im Gegenteil … ! Die unmittelbare Nähe von Schule und Theater in einer einzigen Institution unterstreicht diesen „zielgerichteten“ Aspekt.
Worum es der „Schule!‘ geht, wird bereits deutlich in der Art und Weise der Auswahl von Schauspielern, die an einem Kurs teilnehmen wollen. Die Schul- Struktur sieht vor, daß am Ende nicht nur potentiell gute Schauspieler zugelassen werden, sondern künstlerische Individuen, die zusammen ein kompaktes Theater-Ensemble bilden können: das zukünftige (oder ein zukünftiges) Ensemble des Theaters „Schule der dramatischen Kunst“. Betrachten wir also zunächst das Auswahlverfahren, bevor wir uns dem weiteren Verlauf zuwenden, und seine Bedeutung für den pädagogischen Weg der Schüler, für das Leben der „Schule“ und für die künstlerische Zielsetzung.
2) DAS AUSWAHLVERFAHREN /DIE WAHL DER SCHÜLER
Das Auswahlverfahren ist in mehrere Abschnitte unterteilt. 1991 fand in Rom ein Auswahl-verfahren statt, um für das Gemeinschafts-Projekt „jeder nach seiner Art“ die Teilnehmer zu bestimmen; dieses Verfahren unterschied sich in seiner Beschaffenheit grundlegend nicht von dem in Rußland an der „Schule“ angewandten. Ich konnte diesem Auswahlverfahren persönlich beiwohnen. Der erste Abschnitt war zwei Pädagogen aus der „Schule der dramatischen Kunst“ anvertraut, die ungefähr 200 Schauspieler antrafen. (Ich werde von hier an für die Lehrer, die mit Vassiljev arbeiten, und für Vassiljev selbst, den Begriff USI „Pädagoge“ anwenden, der die direkte Übersetzung des russischen pedagog ist. Das Wort ähnelt prepodavatel‘- Lehrer, hat aber eine andere Bedeutung. Der pedagog beschränkt sich nicht darauf, eine theatralische Technik zu lehren: er erzieht, er formt die künstlerische Persönlichkeit des Schülers und er ist moralisch für dessen berufliches Ethos verantwortlich). Im Laufe dieser Proben mußte jeder Schauspieler einem der Pädagogen ein Stück in Versen, ein Stück aus einer Komödie und ein Stück aus einer Tragödie vorsprechen. Fast immer fand auch ein Gespräch statt, das vor allem zum gegenseitigem Kennenlernen und zum Meinungs-Austausch über Kunst dienen sollte. Die Pädagogen wählten 40 Schauspieler aus, die dann alle zusammen erscheinen mußten und die Aufgabe erhielten, aus Heute abend wird aus dem Stegreif gespielt ohne Hilfe Szenen vorzubereiten und vorzuspielen (mit nicht mehr als 4 Personen). Die Schauspieler sollten sich ihre Partner allein aussuchen und hatten einen Tag zur Vorbereitung zur Verfügung. Von diesem Abschnitt des Auswahlverfahrens an wurden die Proben immer in Anwesenheit sowohl der Pädagogen Vassiljevs als auch der anderen Schauspieler abgehalten. Auf der Grundlage dieser Szenen fand eine weitere Auswahl statt, die 2 8 Teilnehmer bestanden. Am nächsten Morgen erhielten die noch verbliebenen Schauspieler die Aufgabe, einige Szenen aus den“Intermezzi im Foyer” aus Heute abend wird aus dem Stegreif gespielt vorzubereiten (es handelt sich dabei um die fünf Szenen zwischen dem zweiten und dem dritten Akt; während des Bühnen-Umbaus läßt Pirandello seine Schauspieler-Personen im Foyer unter dem Publikum spielen). Zur Vorbereitung hatte der Schauspieler nur eine knappe Stunde zur Verfügung und war so gezwungen, auf die Bühne zu gehen, ohne den Text auswendig gelernt zu haben: auf diese Weise wurde der Kandidat seiner „Sicherheit“ beraubt und zum Improvisieren gezwungen, er mußte sich entblößen und seine Persönlichkeit zeigen.
 Danach wurde die Aufgabe gestellt, einen Monolog vorzubereiten und darzubieten, der sich am Schlußmonolog Momminas orientiert. Das heißt, der Schauspieler mußte die Struktur und die Bedeutung jenes Monologs nachvollziehen, dabei aber die Original-Erzählung Momminas mit einer von ihm erfundenen Erzählung (und improvisiertem Text) ersetzen, wobei diese – nach Meinung des Schauspielers – konzeptionell und emotional der Erzählung Momminas entsprechen sollte. Dann wurden die Schauspieler für den folgenden Tag bestellt, an dem jeder einen selbstgewählten Monolog vorführte, an Improvisations-Trainings teilnahm und Fragen Vassiljevs beantwortete, die sich bezogen auf ihre künstlerischen Neigungen, auf schon gespielte oder gern zu spielende Lieblingsrollen usw. Abends dann wurden die Ergebnisse bekanntgegeben: 17 Schauspieler waren ausgewählt worden. (Es gibt eine Video-Aufzeichnung dieses Auswahlverfahrens : ein Dokumentarfilm unter der Regie des Journalisten Nico Garrone und produziert von RAI 3, mit dem Titel Provini d’autore – Autoren-Proben).
Danach wurde die Aufgabe gestellt, einen Monolog vorzubereiten und darzubieten, der sich am Schlußmonolog Momminas orientiert. Das heißt, der Schauspieler mußte die Struktur und die Bedeutung jenes Monologs nachvollziehen, dabei aber die Original-Erzählung Momminas mit einer von ihm erfundenen Erzählung (und improvisiertem Text) ersetzen, wobei diese – nach Meinung des Schauspielers – konzeptionell und emotional der Erzählung Momminas entsprechen sollte. Dann wurden die Schauspieler für den folgenden Tag bestellt, an dem jeder einen selbstgewählten Monolog vorführte, an Improvisations-Trainings teilnahm und Fragen Vassiljevs beantwortete, die sich bezogen auf ihre künstlerischen Neigungen, auf schon gespielte oder gern zu spielende Lieblingsrollen usw. Abends dann wurden die Ergebnisse bekanntgegeben: 17 Schauspieler waren ausgewählt worden. (Es gibt eine Video-Aufzeichnung dieses Auswahlverfahrens : ein Dokumentarfilm unter der Regie des Journalisten Nico Garrone und produziert von RAI 3, mit dem Titel Provini d’autore – Autoren-Proben).
Derartige Proben, bei denen die Schauspieler vier Tage miteinander verbringen, zusammen Szenen vorbereiten und der Arbeit der anderen beiwohnen, geben Hinweise auf individuelle Eigenschaften der Schauspieler, auf ihre Bereitschaft zur Gruppenarbeit, darauf, ob sie sich auf der Bühne mit ihren Kollegen verständigen können, ihnen zuhören können, sich deren Arbeit gegenüber respektvoll verhalten und daraus kreative Anregungen ziehen können. Man erhält so Informationen über ihre Fähigkeit, sich in ein Ensemble einzubringen worauf die Stanislawski-Tradition immer den größten Wert gelegt hat.‘ (Man braucht nur an das von Stanislawski gelehrte Theater-Ethos zu denken, an die verzweifelten Aufrufe Wachtangows zur Einheit im Ensemble, um sein Drittes Studio zusammenzuhalten, das sich nach der Revolution aufzulösen begann, [71 an die Geschichte des Taganka, dessen Ensemble – aus einem Kurs des Sukin-Instituts hervorgegangen, unter der Regie von Juri Ljubimov – über zwanzig Jahre lang vereint blieb, und so fort).
Die Berichte, die ich bei den Schülern Vassiljevs gesammelt habe, bestätigen, daß die Auswahlverfahren in Rußland sich nicht sehr von denen unterscheiden, denen ich in Rom persönlich beigewohnt habe. So wurde zum Beispiel 1990, um in den neuen Kurs der „Schule“ aufgenommen zu werden, außer den obengenannten Proben von den Bewerbern auch verlangt, einen Einakter zu schreiben, einen Regieplan für irgendein berühmtes Drama vorzulegen – was, aus offensichtlichen sprachlichen Gründen, mit einer Gruppe italienischer Schauspieler unmöglich war – und schließlich folgende Übung – der Schauspieler sollte ein Erlebnis aus seinem eigenen Leben erzählen, das seiner Meinung nach einem Erlebnis einer bekannten literarischen oder dramatischen Figur analog war, und er sollte es so erzählen, als ob er jene Figur wäre und in ihrem Namen spräche (zum Beispiel: die Erzählung, wie man einmal einem Jungen, der den Tod riskierte, nicht zu Hilfe kam, und das als Irina aus Die drei Schwestern von Tschechow; die Erzählung, wie man einer bestimmten Pflicht nicht nachgekommen war aus. Angst vor den unangenehmen Konsequenzen, und das als Don Abbondio «Figur aus Manzonis „Die Verlobten“»; usw.). Diese Übung ähnelt der über den Monolog von Monmüna, sie läßt aber dem Schauspieler noch mehr Freiheit, denn er kann sich das Erlebnis und die Figur aussuchen, die ihm am besten gefallen eine Übung, die ein viel direkteres Involviertsein der Schauspieler-Persönlichkeit sowohl in der Erzählung als auch in der Aktion auf der Bühne vorsieht (und provoziert). [81 Zu Beginn der Bewerber-Auswahl hat man also bereits das zukünftige Theater-Ensemble im Auge. Aber die „Schule der dramatischen Kunst“ ist ein Theater, das nicht nur sehr ausgeprägte stilistische Besonderheiten hat, sondern auch eine ganz eigene Theater- Philosophie, denn seine Arbeit besteht nicht nur in der Ausbildung, sondern auch und vor allem in der Forschung (Theater-, Literatur-, Anthropologie-, Philosophie-, Mystikforschung – wie weit sie auch
immer reichen mag), wie man sie erfährt, wenn man das Textstudium mit der Handlung in Verbindung bringt, und zwar der Handlung auf der Bühne. Um Theater zu machen wie es hier verlangt wird, muß sich der Schauspieler also grundlegend einem völlig anderen System anpassen, einer völlig anderen Idee von Theater, verglichen mit der, die an anderen Theaterschulen gelehrt wird. Er muß sich neu erziehen. Tatsächlich haben alle Schauspieler, die für die Kurse Vassiljevs ausgewählt werden, bereits eine fertige Schauspieler-Ausbildung in der Tasche, und oft sogar eine gewisse Theater-Erfahrung. Das bedeutet, daß die „Schule der dramatischen Kunst“ keine Theater-Grundausbildung gibt, sondern das Ilandwerk eines Theaterkünstlers, der bereits eigene Theater-Grundlagen hat, völlig in Frage stellt. Das ausgewählte Ensemble wird also daraufhin orientiert und vorbereitet, nach einer anderen Theater-Mentalität zu arbeiten, deren Charakteristiken wir im Folgenden, wenn auch nur in groben Zügen, darstellen wollen.
3) DIE LUDISCHEN STRUKTUREN
Das Theater, wie Vassiljev es sieht / konzipiert, basiert auf “ ludischen Strukturen“ – wie er es nennt. Das sind Strukturen, die es erlauben, ein abstraktes Theater zu machen, ein konzeptionelles Theater, ein Theater, in dem es die Ideen sind, die in Konflikt miteinander treten und nicht die Menschen. Nicht immer galt für Vassiljev, daß der Kern der Theateraktion die Ideen sind. «oder sehr frei üb.: Das war nicht immer so für Vassiljev.». Die Theater-Idee seiner ersten vierzehn Jahre Berufspraxis war geprägt vom Stil des sogenannten „psychologischen Realismus“, d.h. von dem Stil, der aus der Tradition des Theaters der Kunst kam und aus einer realistischen, in Rußland weitestgehend verbreiteten Interpretation nach den Lehren Stanislawskis. Einige seiner bekanntesten Inszenierungen (Die erste Version von „Vassa Zeleznova“ von Gorkij 1978 und Die erwachsene Tochter eines jungen Mannes 1979 und Cerceau 1985, beide von V. Slavkin – ein Theaterautor, der der Generation Vassiljevs angehört, sie sind Anfang der 40-er Jahre geboren -) waren solche, in denen man Fragen stellte, in denen geredet wurde, über das Leben der Menschen, über ihre Beziehungen zueinander, über die Gesellschaft und den Einzelnen darin. Die Gorkij-Inszenierung drehte sich um die Problematik von Macht-Beziehungen und um Macht-Kämpfe innerhalb der Familie. Auch die anderen beiden Inszenierungen hatten eine „soziale“ Thematik. Die erste (Die erwachsene Tochter eines jungen Mannes) erzählte von den Problemen der unter Stalin aufgewachsenen Generation und von der Beziehung des sowjetischen Menschen zu der Gesellschaft, in der er lebte. Die zweite (Cerceau – die auch im Teatro Argentino in Rom zur Jahreswende 1988/89 aufgeführt wurde) war in erster Linie ein Gleichnis über die Suche nach dem Schönen und nach der Vereinigung im Schönen in einer Welt – wie der sowjetischen -, die diese Notwendigkeit auszuschließen schien.
Vassiljevs stilistische Wende, auf die die lange Arbeit an Cerceau hingeführt hatte (fast fünf Jahre dauernde Proben, wenngleich mit vielen Unterbrechungen), kam mit Sechs Personen suchen einen Autor von Pirandello im Jahre 1987. Seither macht Vassiljev ein Theater – und das immer radikaler je mehr Zeit verstreicht -, in dem die Handlung nicht abhängt von den Erlebnissen der Menschen und den gesellschaftlichen Begebenheiten, sondern von den dahinterstehenden Ideen, den dahinterstehenden Kategorien. Dieser Ansatz verlangt vom Schauspieler, daß er nicht mehr gleichzeitig Subjekt und Objekt seines künstlerischen Suchens ist, wie es die russische Tradition vorsieht (wobei sie den Schauspieler dazu auffordert, im eigenen Innenleben Gefühle und Erlebnisse zu suchen, die denen der Figur analog sind), sondern daß er sich darauf beschränkt, ausschließlich suchendes Subjekt zu sein und es allein dem Drama überläßt, die Rolle des Forschungs-Objekts zu übernehmen. Um es kurz zu machen.- mit Beginn der Textanalyse wird die Hauptkonzentration darauf verlegt, die Ideen, deren Träger die Figur ist, herauszuarbeiten. Um das zustande zu bringen, muß man die ganze Arbeitsausrüstung der russischen Tradition zur Theater-Ausbildung radikal erneuern, sie und ab- und umändern. Um ein Beispiel zu nennen: dieser Ansatz verlangt, daß die Kriterien, auf deren Grundlage man die „gegebenen Umstände“ definiert, neu betrachtet werden, und daß man lernt, nicht mehr die psychologischen Voraussetzungen der Figur als vorrangig anzusehen – resultierend aus ihrer Geschichte, ihrer Stellung, ihren Gefühlen und der Situation, in der sie sich befindet; (wie es hingegen – um ein klares und erhabenes Beispiel zu zitieren – das Alterego Stanislavskis, Torcov, tat, als er, im Kapitel über Gogols Der Revisor in Die Arbeit des Schauspielers an der Rolle, erklärte, welche „gegebenen Umstände“ das Verhalten, die Handlungsweise Chlestakovs hätten beeinflussen können,- in einer “ Indischen Struktur“ werden eben diese „gegebenen Umstände“ entweder in Funktion auf einen Ideenkonflikt interpretiert – und nicht in Funktion auf ihre psychologische Wirkung auf das Verhalten der Figur – oder es werden andere „gegebene Umstände“ gesucht. Es ist offensichtlich, daß nicht alle Theaterstücke sich für ein Theater mit “ ludischen Strukturen“ hergeben. „Moralische“ Stücke – lbsen zum Beispiel oder Ostrowski – sind eher ungeeignet).
Vassiljev war Schüler von M. Knebel (ihrerseits Schülerin von Michail Cechov und Mitarbeiterin Stanislavskis bei seinem letzten pädagogischen Experiment: der Operno-dramatitscheskaja studija). Und obwohl sich seine Theater-Theoretisierungen und seine -Praxis vom Boden der russischen Tradition abheben, haben sie doch ihre Wurzeln tief in eben dieser Tradition. Um – wenn auch nur in groben Zügen – darzulegen, was Vassiljev mit „ludischer Struktur“ meint, scheint uns eine vergleichende Analyse mit der „psychologischen Struktur“ nützlich, also mit jener Struktur, die den weitestverbreiteten Theater-Stil all derer geprägt hat, die sich auf die Stanislawski-Tradition berufen, und das bedeutet auf den psychologischen Realismus.
Bei einer „psychologischen Struktur‘ müssen sich die Schauspieler auf die handelnden Personen beziehen, als wären sie Figuren und d.h. Wesen, die innerhalb des sie betreffenden Geschehnisses leben, die es “an der eigenen Haut“ erfahren, und die sich daher in einer bestimmten Situation an einem bestimmten Punkt des Drama-Ablaufs zwar bewußt sind, wie die Drama-Geschichte bisher mit ihnen verfahren ist, nicht aber, was auf der nächsten Seite desselben Dramas mit ihnen passieren wird.
Bei einer „Ludischen Struktur“ hingegen versinnbildlichen die handelnden Personen Wesen, und das heißt funktionale Einheiten, die zwar der Weiterentwicklung des Dramas dienen, das konkrete (psychologische, soziale, körperliche etc.) Leben aber außen vor lassen; funktionale Einheiten, die die Ideen-Geschehnisse darstellen und dabei die Handlung auf den folgenden Seiten und auch den Ausgang des Dramas genau kennen.
Daraus folgt, daß bei der psychologischen Struktur die Schauspieler als Figuren eines Dramas handeln, als Figuren, die menschliche Eigenschaften haben und die untereinander Beziehungen eingehen aufgrund der Eigenschaft, Mensch zu sein. Ihre Beziehungen werden von den Voraussetzungen bestimmt, die von der Dramenhandlung gegeben sind, und deshalb handeln die Schauspieler auf der Grundlage der zu Anfang des Dramas gegebenen Umstände, welche ihre eigene Position charakterisieren (Vassiljev nennt dieses Zusammenwirken von Umständen Ausgangsbegebenheit).
Nehmen wir als Beispiel – in vereinfachter Interpretation – die vierte Szene des ersten Aktes aus Jeder nach seiner Art, bei der ich das Glück hatte, mit Vassiljev arbeiten zu können.
Würden wir diese Szene unter dem Gesichtspunkt der psychologischen Struktur analysieren, würden wir sie so sehen.- Donna Livia, die Mutter von Doro Palegari, hat erfahren, daß ihr Sohn während einer Diskussion mit einem seiner besten Freunde, bei der es fast zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre, eine gewisse Delia Morello verteidigt hat, einen Vamp, auf deren Gewissen schon der Selbstmord zweier Männer geht, deren Ruf recht zweifelhaft und deren Herkunft unbekannt ist. Donna Livia ist sehr besorgt und versucht, unterstützt von zwei Freunden, von einem anderen Freund ihres Sohnes, Diego Cinci, zu erfahren, was nun wirklich vorgefallen sei und ob Doro tatsächlich in dieses „Frauenzimmer“ verliebt sei. Es scheint, daß Diego nichts Genaues weiß. Aus dieser Anfangssituation nun (Donna Livia hat vom Streit Doros mitseinem Freund erfahren und ist um ihren Sohn besorgt, die Freunde sind zuvorkommend und möchten ihr gern helfen, versuchen aber gleichzeitig, hie und da die Situation zu entschärfen, Diego kann oder will nicht Stellung beziehen) rühren bestimmte Beziehungen zwischen den Figuren her, und folglich bestimmte Wendepunkte «Peripetien» im Dramenverlauf (der sich hier zu einem langen und immer drängenderen „Verhör“ entwickelt). Die Schauspieler, die diese Szene spielen wollen, müssen diese Beziehungen untereinander aufbauen, sich in die innere Verfassung der Figuren versetzen (Donna Livia ist besorgt, die Freunde sind zuvorkommend, Diego ist verschlossen) und der Entwicklung des Dramas folgen, wobei sie ihre Beziehungen zueinander von Mal zu Mal den dramatischen Positionen anpassen müssen, die sich infolge der Handlungsentwicklung gebildet haben (zum Beispiel wird die Besorgnis Donna Livias in dem Moment ansteigen, in dem sie erfährt, daß nicht ein Mann, sondern zwei sich wegen Delia umgebracht haben, sie wird mehr Druck auf Diego ausüben, die Freunde werden verlegen und ziehen sich angesichts der steigenden Spannung immer mehr zurück).
Bei der „Iudischen Struktur“ hingegen werden die Schauspieler als Wesen handeln und deshalb weder die psychologische oder menschliche Problematik, die für die Figur typisch ist, übernehmen noch die Figur selbst, sondern, im Gegenteil, alle beide auf Distanz halten, obgleich sie sie nicht aus den Augen verlieren. Die Schauspieler-Wesen werden sich nicht am Leben der Figur orientieren, sondern nur an der ideellen Problematik, deren Träger die Figur innerhalb des Dramas ist. Auch die Beziehung, die sich auf der Bühne zwischen den anderen Schauspielern einstellt, wird eine Beziehung zwischen Schauspieler-Wesen sein oder besser, sehr vereinfacht dargestellt, zwischen Schauspielern die selbst auf der Bühne spielen, im Sinne von ludere, und nicht zwischen Schauspielern, die versuchen, die Figuren zu sein oder sich in sie zu verwandeln. [14] Diese Beziehungen organisieren sich daher nicht, wie es bei der psychologischen Struktur geschieht, als Folge der Situation, in der sich die Figuren befinden, sondern vielmehr in Funktion auf den ideellen Zweck des Dramas: sie sind bestimmt vom (dialektischen) Weg, den man nehmen muß, um bei den Ideen anzukommen, die in der Begebenheit eingeschlossen sind, welche die Entwicklung des Dramas abschließt (und die Vassiljev Hauptbegebenheit nennt).
Zum Beispiel ist unter diesem Aspekt – die Analyse ist hier wirklich sehr vereinfacht – der Motor dieser oben beschriebenen Szene der abschließende Monolog Diegos, in dem er mit einem Gleichnis über den Tod seiner Mutter von der Unerkennbarkeit der Dinge und des Menschen spricht; und im Wesentlichen entwickelt sich diese Szene dann zu einem Disput zwischen Donna Livia und Diego über Erkennbarkeit und über Wissen und führt schließlich zu dieser Schlußfolgerung (die Donna Livia nicht akzeptieren wird, das aber steht in Bezug zur Fortsetzung des Stücks). Um diese Szene in „ludischer Struktur“ zu spielen und zu dieser Schlußfolgerung zu kommen, müssen die Schauspieler begreifen, wie die Aktion im Drama strukturiert ist, das heißt sie müssen begreifen, wo die Übergänge im dialektischen Spiel sind, die zu dieser Schlußfolgerung führen, und sie müssen versuchen, diese Struktur nachzuverfolgen und beim Finale anzukommen. Die Beziehungen zwischen den Schauspieler-Wesen auf der Bühne stehen in Funktion zur Entwicklung der Aktion und das heißt, sie versinnbildlichen einen ‚Iudischen‘ Konflikt, einen spielerischen, der nicht bestimmt ist von den Voraussetzungen, welche die Situation der Figuren am Anfang des Stücks ausmachen, sondern der eben nur von der Notwendigkeit bestimmt ist, die die Drama-Struktur aufgibt (um es kurz und stark vereinfacht zu sagen: nicht „weil ich die Mutter von Doro bin, mache ich mir Sorgen um sein weiteres Leben und möchte von dir Genaueres wissen“ und [151 „weil ich der Freund von Doro bin, sage ich dir nichts Genaueres“-, sondern „um dieses bestimmte philosophische Ziel zu erreichen, braucht man zwei Parteien in einem dialektischen Konflikt, die diesen Weg beschreiten; du besetzt die eine Position, ich die andere und wir handeln danach“). Diese Einstellung fordert natürlich Distanz von den Wechselfällen der Figur, von der «vorgegebenen» Handlung. Zum Beispiel wird es hier unwichtig für die Schauspieler, sich als Mutter oder als Freund von Doro zu definieren andererseits wird ein tiefes, persönliches, emotionales Verständnis vonseiten des Schauspielers unerläßlich (ein Verständnis, das er nur im Handeln auf der Bühne erreichen kann), und zwar ein Verständnis der im Text behandelten philosophischen Problematik und ihrer Entfaltung darin. (Man muß hier anmerken, daß diese Analyse der vierten Szene des ersten Aktes von jeder nach seiner Art nicht nur sehr vereinfacht, sondern auch aufgrund der Veranschaulichung sehr verkürzt wurde. Vassiljevs Analyse sah in der Tat in dieser Szene ein Zusammenwirken von Indischen und psychologischen Strukturen vor. Nach Vassiljev ist gar einer der typischen stilistischen Züge Pirandellos der kontinuierliche Wechsel einer handelnden Person vom Abstrakten zum Konkreten, vom Realen zum Imaginären; eine Wechselhaftigkeit, die eben die gleichzeitige Anwendung beider Strukturen verlangt)
Wenn also in einer psychologischen Struktur der stanislawskische Satz „ich unter gegebenen Umständen“ übersetzt werden kann mit „ich unter emotionalen, umgebungsabhängigen und physischen Umständen, in denen sich die Figur befindet“, so wird derselbe Satz in der „Iudischen Struktur“ übersetzt mit „ich unter den Umständen, die mir die Aktions- Struktur (ausgerichtet auf die Hauptbegebenheit) des Werkes vorgibt.“ Die Schauspieler-Figur weiß nicht genau, wohin sie auf dem Weg ist, aber sie weiß sehr wohl, woher sie kommt. Das Schauspieler-Wesen weiß weniger genau, woher es kommt, aber es weiß hundertprozentig, wohin es geht und wie es dorthin kommt.
In einer psychologischen Struktur wird der Schauspieler seine Emotionalität, seine Gefühle leiten aufgrund der Beziehungs- Rekonstruktion der Figuren untereinander und aufgrund seiner inneren Einstellung als Schauspieler-Figur. In einer „Iudischen Struktur“ wird der Schauspieler seine Emotionalität, seine Gefühle leiten aufgrund seines Verstehens der umfassenden philosophischen Ideen und Bedeutungen des Werks.
Um es noch einmal zusammenzufassen: das Ensemble der Schauspieler, die in der „Schule der dramatischen Kunst“ Aufnahme fanden, wird dazu angeleitet, eine abstrakte, eine konzeptionelle Situation zu handhaben, die nicht dem konkreten Leben, sondern dem Leben der Ideen entnommen ist. Ihm wird beigebracht, die Aktions-Struktur des Dramas zu untersuchen. Es lernt, Distanz zu halten zwischen sich und der Rolle und diese Distanz dazu zu verwenden, frei zu spielen und zu improvisieren, sich nicht mit der Figur zu identifizieren; die Komposition des Dramas zu handhaben, das heißt während seines Handelns sich immer des Folgenden und vor allem der Hauptbegebenheit bewußt zu sein, auf die hin es sich zubewegt; «es wird dazu angeleitet,» über den ideellen Sinn des Werkes nachzudenken und nicht über die Angelegenheiten der Figuren.
Dieser theoretische Ansatz, der vom Schauspieler vor allem verlangt, sich selbst und seine künstlerische Aufmerksamkeit ’nach außen‘ zu wenden und also dem Drama als solchem zu, der Aktions-Struktur zu, «dieser Ansatz» kann als eine Fortentwicklung gewisser Elemente aus dem theoretischen Erbe von M. Cechov angesehen werden, besonders seines Postulats, demzufolge die künstlerischen Bilder (obrazy) der Figuren in einer der unseren übergeordneten Welt ein autonomes Leben führen. Nach Michail Cechov muß der Schauspieler seine kreativen Bemühungen dieser Welt zuwenden, er muß sich die Aufgabe stellen, mit den Bildern in Kontakt zu kommen und dann muß er sie so lange imitieren, bis er beginnt, „aus Sym-Pathie“ das zu fühlen was sie fühlen. Aus dem Buch von M. Cechov „An den Schauspieler“: Da leuchten aus den Erinnerungen der Vergangenheit hier und da völlig unbekannte Bilder auf. (…) Diese Bilder erscheinen, verschwinden wieder, kommen aufs Neue zurück und bringen neue und unbekannte Elemente mit sich. Und da treten sie in Beziehung zueinander. Sie beginnen unabhängig von euch zu ‚handeln‘ und zuspielen‘, vor euren faszinierten Augen, sie führen euch durch ihre vergangenen und geheimnisvollen Leben. ( … ) Euer Geist ist hellwach und aktiv. Die persönlichen Erinnerungen werden immer schwächer und die neuen Bilder besitzen ein unabhängiges Leben. (..) Diese faszinierenden Gäste, die ein Eigenleben voller Emotionen führen, wecken eure Sensibilität für neue Reaktionen. Sie zwingen euch, mit ihnen zu lachen und zu weinen. Wie durch einen Zauber wecken sie in euch den unmöglichen Wunsch, zu ihnen zu gehören. Jetzt beginnt ihr einen Dialog mit ihnen, ihr stellt euch vor, in ihrer Gesellschaft zu sein: ihr möchtet sie nachahmen. Diese Bilder haben euch aus einer passiven Geistesverfassung in einen kreativen Zustand gehoben.“ Im weiteren Verlauf des Buches behauptet M. Cechov, daß der Schauspieler, nachdem er das künstlerische Bild der Figur ‚heraufbeschworen‘ hat, es „verhören“ muß, und er gibt als sein bevorzugtes Instrument dazu die Improvisation an, das freie Spiel auf der Bühne.
Hier muß jedoch angemerkt werden, daß für M. Cechov der nächste Schritt nach der Beschwörung und nach dem Verhör des Bildes die Imitation desselben sein sollte, das heißt die Schaffung einer Figur auf der Bühne, welche jener der ideellen Bilderwelt analog ist. [18] Nicht nur das: für M. Cechov scheint die Beziehung zu dem Bild sich auf die Phase des Rollen-Aufbaus zu beschränken. Außerdem, wenn man seinen Beschreibungen über die Arbeit an der Figur glaubt, scheint M. Cechov sich innerhalb der Theaterpoetik des psychologischen Realismus zu bewegen, auch wenn uns die Aufführungsgeschichte seiner Stücke eines anderen belehrt, denn in ihnen trat eine spirituelle und mystische Suche zum Vorschein, die stark beeinflußt war vom anthroposophischen Gedankengut Steiners.
Für Vassiljev hingegen muß der Schauspieler, während er spielt, das Bild der Figur auf Distanz halten, besser ausgedrückt: die Idee der Figur, und er muß auf der Bühne eine spielerische, eine freie Beziehung mit ihr eingehen. Gleichzeitig richtet sich seine ganze Aufmerksamkeit nicht auf die Nachahmung des Bildes der Figur, sondern auf den Weg der konzeptionellen Aktion, den er beschreiten muß, um die Hauptbegebenheit zu erreichen. Daraus folgt, daß das künstlerische Bild, das ihn erfüllen muß, dessen Vermittler er werden muß, nicht jenes der Figur ist, sondern jenes der Idee, von der die Figur, die handelnde Person, Funktion und Ausdruck ist.
So wird er also – um diese Zielsetzung zu erreichen, die wir mit konkret, mit utilitaristisch bezeichnet haben und die aus dem Schüler eine neue Stütze des Theater-Ensembles machen soll – dazu angeleitet, seine bisherige Denkweise und seine bisherige Art, Theater zu machen, zugunsten eines idealistischen Rahmens umzustoßen.
Welches ist nun der Weg, den der Schüler gehen muß, um das von ihm verlangte Ziel zu erreichen? Oder anders gesagt: wie ist Vassiljevs „Schule der dramatischen Kunst“ aufgebaut? Wir werden das anhand der Beschaffenheit der letzten drei, von Vassiljev in seinem Theater geleiteten, Ausbildungskurse für Regisseure und Schauspieler sehen. (Im Moment gibt es keine Kurse an der „Schule der dramatischen Kunst“, aber es ist wahrscheinlich, daß bald ein neuer aufgebaut wird.)
4) AKTIVITÄTEN UND STRUKTUR DER „SCHULE DER DRAMATISCHEN KUNST“ (1987 bis 1995)
Der Studienkurs der „Schule der dramatischen Kunst“ dauert fünf Jahre und ist als Fernkurs organisiert. Mit dem Wort “ Fernkurs“ meine ich den russischen Ausdruck zaocnyi kurs, was wörtlich übersetzt „Kurs jenseits der Augen“ bedeuten würde (za – jenseits, oci – Augen) und was im Wörterbuch mit “ Fernunterricht, Fernstudiuim” «Daum-Schenk» übersetzt wird.
Die typische Organisation eines solchen Kurses an den russischen Theaterinstituten sieht wie folgt aus: einige Regisseure und Schauspieler aus verschiedenen Gegenden Rußlands, aber auch aus dem Ausland, treffen sich alle fünf Monate im Institut und wohnen derweil in Appartements und Zimmern des Instituts. Hier, während einer etwa einmonatigen Zeitspanne intensiver Arbeit (die sessija heißt, das bedeutet „Sitzung“), beschäftigen sie sich mit den vom Pädagogen gestellten Aufgaben, legen Prüfungen ab, erhalten ‚Hausaufgaben‘ für
die folgenden fünf Monate und trennen sich am Ende wieder. Wenn sie ein festes Engagement haben, gehen sie an ihr Theater zurück und versuchen das in der letzten ‚Sitzung‘ Erarbeitete in die Praxis umzusetzen. Die Schüler machen die Aufgaben, die ihnen gestellt
worden sind, und nach fünf Monaten treffen sie sich wieder im Institut, und jeder bringt neue Fragen mit und neue Probleme. Derartige ‚Sitzungen‘ finden zweimal pro Jahr statt: im Herbst und im Sommer. Der Kurs dauert fünf Jahre, das bedeutet zehn ‚Sitzungen‘. Die ‚Sitzung‘ ist so unterteilt, daß ein Teil nur der Theaterkunst gewidmet wird und ein anderer der allgemeinen Ausbildung (der etwa 10 Tage dauert), bei der die Schüler abgehört werden und Prüfungen in folgenden Fächern ablegen. Geschichte, Geschichte der Bildenden Künste, Aesthetik, Philosophie-Geschichte, Russische Theatergeschichte, Westeuropäische Theatergeschichte, Russische Literatur, Ausländische Literatur, Sittengeschichte, Regiegeschichte des Zwanzigsten Jahrhunderts usw.
Eine szenische Darbietung der gefundenen Ergebnisse schließt jede letzte ‚Sitzung‘ eines Akademischen Jahres ab und die Abgeordneten des Lehrerkollegiums des Instituts wohnen ihr bei. Am Ende der allerletzten Kurs-Sitzung findet eine Aufführung statt.
Dieses Modell eines Kurses für Fernstudierende wird von der „Schule der dramatischen Kunst“ nur teilweise übernommen, denn bei den verschiedenen Kursen, die bis heute an dieser Schule abgehalten worden sind, ist es immer wieder Änderungen unterworfen worden. Zwar wurden in der Anfangsphase die Kurse getreu diesem Modell