Vortrag vor Kunststudenten (1883)
Oskar Wilde
Der Vortrag, den ich die Ehre habe heut Abend vor Ihnen zu halten, soll Ihnen keine abstrakte Definition der Schönheit geben. Denn wir, die in der Kunst arbeiten, können nicht eine Theorie der Schönheit als Ersatz für die Schönheit selbst gelten lassen, und weit davon entfernt, sie in einer verstandesmäßigen Formel isolieren zu wollen, suchen wir vielmehr sie in einer Form zu materialisieren, die durch die Sinne die Seele erfreut. Wir möchten sie schaffen, nicht definieren. Die Definition soll dem Werke folgen; das Werk soll sich nicht der Definition anpassen.
Nichts fürwahr ist dem jungen Künstler so gefährlich wie irgendeine Auffassung von idealer Schönheit; sie verführt ihn beständig zu schwächlicher Niedlichkeit oder lebloser Abstraktion. Wollen Sie jedoch das Ideal erreichen, so dürfen Sie es nicht seines lebendigen Wesens entkleiden. Sie müssen es im Leben finden und in der Kunst neu schaffen.
Ich möchte Ihnen also einerseits keine Philosophie der Schönheit geben – denn was ich heut Abend vorhabe, ist: zu untersuchen, wie wir Kunst schaffen, nicht wie wir davon reden können -, andrerseits wünsche ich nicht, ein Thema wie Geschichte der englischen Kunst zu behandeln.
Zunächst bedeutet ein solcher Ausdruck wie englische Kunst nichts. Man könnte ebenso gut von englischer Mathematik sprechen. Die Kunst ist die Wissenschaft der Schönheit, und die Mathematik ist die Wissenschaft der Wahrheit; beide haben keine nationale Schule. Ja, eine nationale Schule ist lediglich eine provinziale Schule. Es gibt überhaupt nichts derartiges wie eine Schule der Kunst. Es gibt nur Künstler – weiter nichts.
Und was Kunstgeschichten betrifft, so sind sie ganz Wertlos für Sie, es sei denn, Sie strebten nach der ruhmreichen Vergessenheit einer Kunstprofessur. Es hat keinen Zweck für Sie, die Jahreszahlen Peruginos oder den Geburtsort eines Salvator Rosa zu kennen; alles, was Sie von Kunst wissen sollen, ist: ein gutes Bild zu erkennen, wenn Sie es sehn, und ein schlechtes, wenn Sie es sehn. Was die Lebenszeit des Künstlers angeht, so sicht jede gute Arbeit vollkommen modern aus: eine griechische Skulptur, ein Porträt von Velasquez – sie sind immer modern, gehören immer unsrer Zeit an. Und was die Nationalität des Künstlers betrifft, so ist die Kunst nicht national, sondern universal. Meiden Sie also die Archäologie durchaus! Die Archäologie ist lediglich die Wissenschaft, schlechte Kunst zu Entschuldigen; sie ist der Fels, an dem mancher junge Künstler scheitert und Schiffbruch leidet; sie ist der Abgrund, aus dem kein Künstler, alt oder jung, je zurückkehrt. Oder wenn er zurückkehrt, ist er so vom Staub und Moder der Zeit bedeckt, dass er als Künstler ganz unkenntlich ist und sich für den Rest seines Lebens unter dem Barett eines Professors oder als Illustrator alter Geschichte verborgen halten muss. Wie wertlos die Archäologie in der Kunst ist, können Sie daran ermessen, dass sie so populär ist. Popularität ist der Lorbeerkranz, den die Welt schlechter Kunst aufsetzt. Was populär ist, ist vom Übel.
Da ich also nicht über die Philosophie des Schönen und die Geschichte der Kunst sprechen will, werden Sie mich fragen, worüber ich denn hier sprechen möchte. Das Thema meiner heutigen Vorlesung lautet: was macht einen Künstler, und was macht der Künstler? Welches ist das Verhältnis des Künstlers zu seiner Umgebung, welche Bildung soll der Künstler empfangen, und was ist das Wesen eines guten Kunstwerks?
Zuerst ein paar Worte über das Verhältnis des Künstlers zu seiner Umgebung, worunter ich das Zeitalter und das Land verstehe, in dem er geboren ist. Alle gute Kunst hat, wie ich vorhin sagte, nichts mit einem besondern Jahrhundert zu tun; diese Universalität ist das Wesen des Kunstwerks; aber die Bedingungen, die dieses Wesen erzeugen, sind verschieden. Sie sollten, meiner Ansicht nach, Ihre Zeit völlig begreifen, um sich völlig von ihr zu abstrahieren. Bedenken Sie, dass, wenn Sie überhaupt Künstler sind, Sie nicht das Mundstück eines Jahrhunderts, sondern Herr der Ewigkeit sein werden; dass alle Kunst auf einem Grundsatz beruht, und dass rein zeitliche Erwägungen überhaupt kein Grundsatz sind; und dass die, welche Ihnen raten, in Ihrer Kunst das neunzehnte Jahrhundert zu spiegeln, Ihnen den Rat geben, eine Kunst zu schaffen, die Ihre Kinder, wenn Sie welche haben, für altmodisch halten. Aber Sie werden mir sagen: dies ist eine unkünstlerische Zeit, und wir sind ein unkünstlerisches Volk, und der Künstler leidet sehr in diesem unserm neunzehnten Jahrhundert.
Natürlich leidet er. Ich leugne das am allerwenigsten. Aber bedenken Sie: es hat nie eine künstlerische Zeit, nie ein künstlerisches Volk gegeben, seitdem die Welt steht. Der Künstler ist immer eine auserlesene Ausnahme gewesen und wird es immer sein. Es gibt kein goldenes Zeitalter der Kunst – nur Künstler, die geschaffen haben, was goldener ist als Gold.
Aber wie, werden Sie mir einwenden, verhält es sich mit den Griechen? Waren sie nicht ein künstlerisches Volk?
Nun, die Griechen sicher nicht, aber vielleicht meinen Sie die Athener, die Bürger einer einzigen Stadt unter tausenden.
Halten Sie die Athener für ein künstlerisches Volk? Betrachten wir sie zur Zeit ihrer höchsten künstlerischen Blüte in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v. Chr., als sie die größten Dichter und die größten Künstler der alten Welt hatten, als der Parthenon auf Geheiß eines Phidias in seiner Anmut erstand, als der Philosoph im Schatten der gemalten Säulenhalle Weisheit lehrte und die Tragödie in hehrer Hoheit über die marmorne Bühne zog. Waren sie damals ein künstlerisches Volk? Nicht im mindesten. Was ist ein künstlerisches Volk andres als ein Volk, das seine Künstler liebt und ihre Kunst versteht? Die Athener konnten beides nicht.
Wie haben sie Phidias behandelt? Phidias verdanken wir die große Zeit, nicht nur in der griechischen, sondern in aller Kunst ich meine: da der Gebrauch des lebenden Modells aufkam.
Und was würden Sie sagen, wenn sämtliche englischen Bischöfe, hinter denen das englische Volk stünde, eines Tages von Exeter Hall zur Royal Academy zögen und Sir Frederick Leighton in einem grünen Wagen nach Newgate ins Gefängnis schafften auf die Beschuldigung hin, er habe Ihnen gestattet, lebende Modelle in Ihren Entwürfen zu religiösen Bildern zu benutzen?
Würden Sie nicht laut protestieren gegen die Barbarei und das Puritanertum einer solchen Idee? Würden Sie nicht geltend machen, dass die schlimmste Art, Gott zu ehren, darin besteht, den Menschen zu entehren, der nach seinem Bilde geschaffen und das Werk seiner Hände ist; und dass man, wenn man Christus malen will, die Christus ähnlichste Person nehmen muss, die sich finden lässt, und, wenn man die Madonna malen will, das reinste Mädchen, das man kennt?
Würden Sie nicht hinlaufen und, wenn nötig, das Gefängnis niederbrennen und sagen, ein solcher Vorgang sei ohnegleichen in der Geschichte?
Ohnegleichen? Nun, genau das taten die Athener.
In dem Saal der Parthenon-Gruppen im Britischen Museum können Sie einen Marmorschild an der Wand sehn. Darauf sind zwei Figuren: die eine die eines Mannes, dessen Gesicht halb verborgen ist, die andre die eines Mannes mit den gottähnlichen Zügen des Perikles. Dafür dass er dies getan, dass er in ein, der religiösen Geschichte Griechenlands entnommenes Basrelief das Bild des großen Staatsmannes eingeführt hat, der Athen damals beherrschte, wurde Phidias ins Gefängnis geworfen, und dort, im Kerker des athenischen Staats, starb der wundervollste Künstler der alten Welt.
Und halten Sie das für einen Ausnahmefall? Das Kennzeichen eines philiströsen Zeitalters ist der Vorwurf der Immoralität gegen die Kunst, und dieser Vorwurf wurde vom athenischen Volke gegen jeden großen Dichter und Denker seiner Zeit erhoben gegen Äschylus, Euripides, Sokrates. Ebenso war es im Florenz des dreizehnten Jahrhunderts. Die Tüchtigkeit des Handwerks ist den Gilden, nicht dem Volke zu danken. Sobald die Gilden ihre Macht verloren und das Volk aufkam, war es mit schöner, anständiger Arbeit vorbei.
Und darum reden Sie nie von einem künstlerischen Volk; dergleichen hat es nie gegeben.
Aber vielleicht werden Sie mir sagen: die äußere Schönheit der Welt ist uns fast ganz entschwunden, der Künstler wohnt nicht mehr inmitten der reizenden Umgebung, die in früheren Zeiten das natürliche Erbe jedes einzelnen war, und die Kunst ist sehr schwer in dieser unsrer reizlosen Stadt, wo man, wenn man morgens zur Arbeit geht oder abends von ihr zurückkehrt, durch eine Straße nach der andern kommt mit der törichtsten, dümmsten Architektur, die die Welt je erlebt hat; einer Architektur, in der jede reizende griechische Form entweiht und geschändet, jede reizende gotische Form entweiht und geschändet ist, so dass drei Viertel der Häuser in London lediglich zu viereckigen Kasten von den gemeinsten Größenverhältnissen geworden sind, ebenso elend wie rußig und ebenso armselig wie anspruchsvoll – die Flurtür immer falsch in der Farbe, die Fenster falsch in der Größe und wenn Sie, der Häuser überdrüssig, sich anschickten, die‘ Straße selbst zu betrachten, so gäbe es nichts für Sie zu sehn als Zylinderhüte, Männer mit Plakaten auf Brust und Rücken, zinnoberrote Briefkasten, und dabei müssten Sie noch befürchten, von einem grasgrünen Omnibus überfahren zu werden.
Hat es die Kunst nicht schwer, werden Sie mir sagen, in einer solchen Umgebung? Selbstverständlich hat sie es schwer, aber leicht hatte es die Kunst nie; Sie selbst möchten ja auch gar nicht, dass sie es leicht hat; und außerdem ist nichts der Mühe wert als das, was die Welt für unmöglich erachtet.
Sie wollen jedoch nicht bloß mit einem Paradoxon abgespeist werden. Welches sind die Beziehungen eines Künstlers zu der äußeren Welt, und was folgt für Sie aus dem Verlust einer schönen Umgebung? Das ist eine der wichtigsten Fragen der modernen Kunst; und auf keinen Punkt legt Ruskin solchen Nachdruck wie darauf, dass der Verfall der Kunst sich aus dem Verfall schöner Gegenstände ergeben hat und dass die Schönheit, wenn der Künstler sein Auge nicht an ihr weiden kann, aus seinem Werke verschwindet.
Ich erinnere mich, in einer seiner Vorlesungen entwirft er uns, nachdem er den schmutzigen Anblick einer englischen Großstadt beschrieben, ein Bild, wie sich die künstlerische Umgebung früher ausgenommen hat.
Stellt euch vor, sagt er in Worten von vollendeter, malerischer Bildkraft, deren Schönheit ich nur schwach wiederzugeben vermag, stellt euch vor, welch ein Schauspiel sich einem Zeichner der gotischen Schule – Nino Pisano oder einem seiner Gehilfen – auf seinem Nachmittagsspaziergang bot:
»Zu beiden Seiten eines leuchtenden Flusses sah er eine Reihe leuchtenderer Paläste mit Bogen und Säulen, mit tiefrotem Porphyr und Nephrit ausgelegt, emporragen; an den Kais sprengten vor ihren Toren Reitertrupps dahin, edel von Angesicht und Gestalt, mit blitzendem Helmbusch und Schild; Ross und Reiter ein einziges Labyrinth von seltsamen Farben und Lichtstrahlen – die Purpur-, Silber- und Scharlachfransen flossen über die starken Glieder und den klirrenden Panzer, wie die Wogen des Meeres über Felsen bei Sonnenuntergang. Auf beide Ufer des Flusses gingen Gärten, Höfe und Klöster hinaus; eine lange Zeile weißer Säulen im Schmucke des Weinlaubs; Fontänen sprangen zwischen blühenden Granatapfel- und Orangenbäumen; und auf den Gartenwegen, unter und zwischen dem Karminrot der Granatapfelschatten bewegten sich langsam Gruppen der schönsten Frauen, die Italien je gesehn – der schönsten, weil reinsten und gedankenvollsten, in allem hohen Wissen wie in aller höfischen Kunst zu Hause: im Tanz, Gesang, in süßem Witze, in edler Bildung, edlerem Mut, der edelsten Liebe – gleichermaßen befähigt, die Seele des Mannes zu erheitern, zu bezaubern oder zu retten. Über dieses ganze Schauspiel vollendeten menschlichen Lebens ragten Dom und Glockenturm, funkelnd in weißem Alabaster und Gold; hinter Dom und Glockenturm die Abhänge mächtiger Hügel, silbergrau von Oliven; weit im Norden, über einem Purpurmeer von Bergspitzen des feierlich ernsten Apennin sandten die klaren, scharf gespaltenen Berge Carraras ihre standhaften Flammen von marmornem Gipfel zum Bernsteinhimmel empor; die große See selbst, unter der weiten Lichtfläche schwelend, erstreckte sich von ihrem Fuße bis zu den Gorgonischen Inseln; und über all dem, ewig gegenwärtig, nah oder fern durch das Weinlaub gesehn oder mit dem Zuge der Wolken im Strome des Arno gespiegelt oder mit seinem tiefen Blau sich scharf abhebend von dem goldnen Haar und den brennenden Wangen des Ritters und der Dame – der ungetrübte, heilige Himmel, der in diesen Tagen eines unschuldigen Glaubens für alle Menschen die unbestrittene Wohnstätte der Geister war, wie die Erde die Wohnstätte der Menschen, und der durch seine Wolkentore und Tauschleier stracks in die ehrfürchtige Ewigkeit führte – ein Himmel, an dem jede vorübergleitende Wolke buchstäblich der Wagen eines Engels war und jeder Strahl seines Abends und Morgens vom Throne Gottes ausging.«
Wie gefällt Ihnen das für eine Zeichenschule?
Und nun betrachten Sie die niederschlagende, monotone Erscheinung einer modernen Stadt, die düstere Kleidung der Männer und Frauen, die nichtssagende, dürftige Architektur, die farblose, schreckliche Umgebung. Ohne ein schönes nationales Leben wird nicht allein die Plastik, werden alle Künste aussterben.
Was das religiöse Gefühl am Ende der Stelle betrifft, so brauche ich darüber wohl nicht zu sprechen. Die Religion entspringt dem religiösen Gefühl, die Kunst dem künstlerischen Gefühl; Sie bekommen nie das eine von dem andern; wenn Sie nicht die richtige Wurzel haben, können Sie nicht die richtige Blume erlangen; und wenn jemand in einer Wolke den Wagen eines Engels sieht, wird er sie wahrscheinlich einer Wolke sehr unähnlich malen.
Aber was die allgemeine Idee in der ersten Hälfte dieser allerliebsten Prosastelle anlangt: ist es wirklich wahr, dass eine schöne Umgebung für den Künstler notwendig ist? Ich glaube nicht; sicher nicht. ja, für mich ist das Unkünstlerischste in unsrer Zeit nicht die Gleichgültigkeit des Publikums gegenüber dem Schönen, sondern die Gleichgültigkeit des Künstlers gegenüber dem, was hässlich genannt wird. Denn für den echten Künstler ist nichts an sich schön oder hässlich. Mit dem Gegenstand an sich hat er nichts zu tun, sondern nur mit seinem Aussehn, und das Aussehn hängt ab von Licht und Schatten, vom Stoff, von der Stellung und vom Tonwert.
Das Aussehn ist tatsächlich bloß eine Sache des Effekts, und mit den Wirkungen der Natur haben Sie sich zu beschäftigen, nicht mit der wirklichen Beschaffenheit des Gegenstands. Was Sie als Maler zu malen haben, sind nicht Dinge, wie sie sind, sondern Dinge, wie sie zu sein scheinen, nicht Dinge, wie sie sind, sondern Dinge, wie sie nicht sind.
Kein Gegenstand ist so hässlich, dass er unter gewissen Licht- und Schattenbedingungen, durch die Berührung mit andern Dingen nicht schön aussehn kann; kein Gegenstand ist so schön, dass er unter gewissen Bedingungen nicht hässlich aussehn kann. Ich glaube, alle vierundzwanzig Stunden sieht das Schöne einmal hässlich und das Hässliche einmal schön aus.
Und die Plattheit eines großen Teils unsrer englischen Malerei scheint mir daher zu kommen, dass so viele unsrer jungen Künstler lediglich das ansehn, was man »Modeschönheit« nennen darf, während Sie als Künstler da sind, nicht um die Schönheit zu kopieren, sondern um sie in Ihrer Kunst zu schaffen, in der Natur auf sie zu warten und nach ihr auszuschaun.
Was würden Sie von einem Dramatiker sagen, der nur tugendhafte Menschen als Personen in seinem Stück auftreten lief3e? Würden Sie nicht sagen, die Hälfte des Lebens entginge ihm? Nun, von dem jungen Künstler, der nur Schönes malt, sage ich: die eine Hälfte der Welt entgeht ihm.
Warten Sie nicht darauf, dass Ihnen das Leben malerisch entgegenkommt, sondern versuchen Sie, das Leben unter malerischen Bedingungen zu sehn. Diese Bedingungen können Sie für sich im Atelier schaffen, denn es sind bloß Lichtbedingungen. In der Natur müssen Sie darauf warten, nach ihnen ausschaun, sie auslesen; und wenn Sie warten und ausschaun, kommen werden sie.
In Gower Street sehn Sie vielleicht bei Nacht einen Briefkasten, der malerisch ist; am Ufer der Themse in London sehn Sie vielleicht malerische Schutzleute. Selbst Venedig ist nicht immer schön, so wenig wie Frankreich.
Malen, was man sieht, ist eine gute Regel in der Kunst; aber sehn, was sich zu malen lohnt, ist besser. Sehn Sie das Leben unter malerischen Bedingungen! Es ist besser, in einer Stadt mit veränderlichem Wetter zu leben als in einer Stadt mit lieblicher Umgebung.
Nachdem wir nun gesehn haben, was den Künstler macht und was der Künstler macht, fragen wir: wer ist der Künstler? Unter uns lebt ein Mann, der alle Eigenschaften vornehmster Kunst in sich vereinigt, dessen Werke eine Freude für alle Zeit sind, der selbst ein Meister für alle Zeit ist. Dieser Mann ist Whistler.
Aber, werden Sie mir sagen, die moderne Kleidung, die ist schlecht. Wenn Sie nicht schwarzes Tuch malen können, hätten Sie auch nicht ein seidenes Wams fertiggebracht. Hässliche Kleidung ist besser für die Kunst – Tatsachen des Sehvermögens, nicht des Gegenstands.
Was ist ein Bild? Ursprünglich ist ein Bild eine schönfarbige Oberfläche, lediglich das, und es hat ebenso wenig eine geistige Botschaft oder Bedeutung für Sie wie ein köstliches Stück venezianisches Glas oder ein blauer Ziegel aus der Mauer von Damaskus. Es ist ursprünglich etwas rein Dekoratives, eine Augenweide.
Alle archäologischen Bilder, die Sie »wie merkwürdig!«, alle sentimentalen Bilder, die Sie »wie traurige, alle historischen Bilder, die Sie »wie interessante sagen lassen, alle Bilder, die Ihnen nicht auf der Stelle eine solche künstlerische Freude bereiten, dass sie Ihnen den Ausruf entlocken »wie schön!«, sind schlechte Bilder.
______________________________
Wir wissen nie, was ein Künstler machen wird. Natürlich nicht. Der Künstler ist kein Spezialist. Alle solche Unterscheidungen wie Tiermaler, Landschaftsmaler, Maler des schottischen Viehs in englischem Nebel, Maler des englischen Viehs in schottischem Nebel, Pferderennen-Maler, Bullterrier-Maler, alle sind seicht. Wer ein Künstler ist, kann alles malen.
______________________________
Der Zweck der Kunst ist, den göttlichsten, entlegensten der Akkorde anzuschlagen, die in unsrer Seele Musik machen; und Farbe ist an sich eine mystische Gegenwart auf der Oberfläche der Dinge und der Ton eine Art Schildwache.
Rede ich also der bloßen Technik das Wort? Nein. Solange irgendwelche Merkmale der Technik vorhanden sind, ist das Bild unfertig. Ein Bild ist fertig, wenn alle Spuren der Arbeit und der Mittel, die aufgewendet werden, um das Resultat hervorzubringen, verschwunden sind.
Bei dem Handwerker – dem Weber, dem Töpfer, dem Schmied – sind die Spuren seiner Hand auf seiner Arbeit. Aber so ist es nicht bei dem Maler; so ist es nicht bei dem Künstler.
Die Kunst soll kein Gefühl haben als ihre Schönheit, keine Technik als das, was sich nicht wahrnehmen lässt. Man soll von einem Bilde sagen können, nicht dass es »gut gemalt«, sondern dass es »nicht gemalt« ist.
Was ist der Unterschied zwischen absolut dekorativer Kunst und einem Gemälde? Die dekorative Kunst betont ihr Material; die Phantasiekunst vernichtet es. Ein Wandteppich zeigt seine Fäden als einen Teil seiner Schönheit; ein Bild vernichtet seine Leinwand, zeigt nichts davon. Porzellan betont seine Glasur; Wasserfarben lassen das Papier verschwinden.
Ein Bild hat keine andre Bedeutung als seine Schönheit, keine Botschaft als seine Freude. Das ist die erste Wahrheit in der Kunst, die Sie nie aus den Augen verlieren dürfen. Ein Bild ist etwas rein Dekoratives.
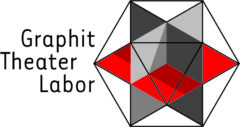






 Undine geht
Undine geht